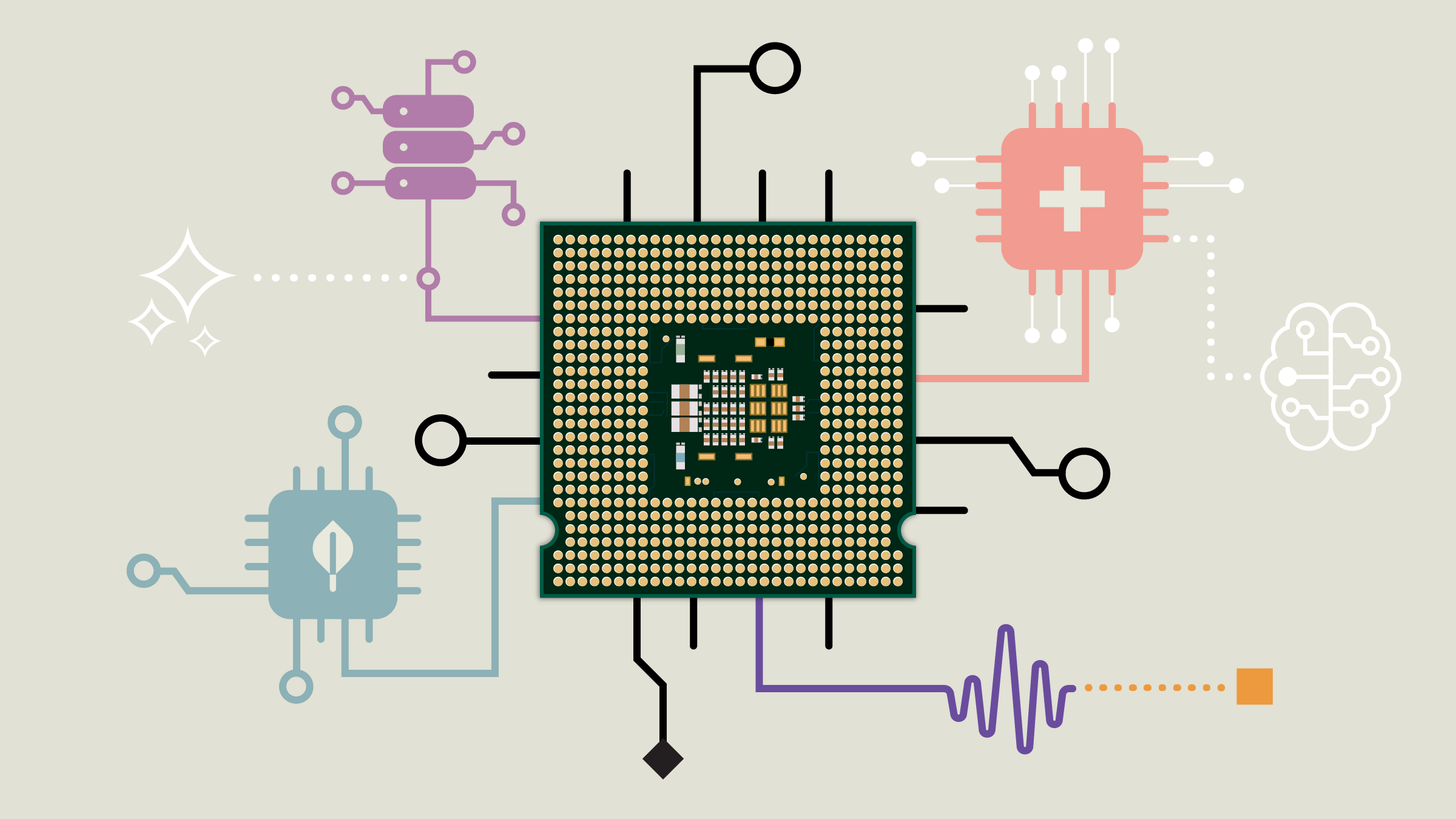Willkommen zum vierten Teil unserer Serie über klassische Verhaltensmuster bei Anlegern! In den vorangegangenen Beiträgen haben wir zahlreiche Themen angesprochen und sind dabei auf einige Grundsätze der immer populäreren Verhaltensökonomie gestoßen. Im ersten Teil unserer Serie ging es darum, welche Rolle Denkfehler im Alltag eines Investors spielen. Im zweiten Teil haben wir die Neue Erwartungstheorie, auch „Prospect Theory“ genannt, auf den Prüfstand gestellt und untersucht, welche Rolle das „gefühlte Risiko“ spielt, wenn wir Entscheidungen treffen. Vergangene Woche haben wir dann das Phänomen der Verlustangst behandelt - die Erkenntnis, dass ein Verlust uns stärker zu schaffen macht als ein Gewinn uns Freude bereitet. All diese Verhaltensweisen machen es schwer, eine rationale und fundierte Anlageentscheidung zu treffen. Auch heute werden wir eine weitere Verhaltensweise thematisieren, die Anlegern das Leben schwer machen kann, ganz gleich, ob man sich für eine aktive oder eine passive Handelsstrategie entscheidet: den so genannten Besitztumseffekt (Englisch: Endowment Effect).
Das als „Endowment Effect“ bekannte Phänomen, das den Grundsätzen der klassischen Wirtschaftstheorie widerspricht, wurde 1980 von Richard Thaler aufgezeigt. Der Wissenschaftler beschrieb dieses Phänomen als das Verhalten, dass „Menschen oft viel mehr dafür verlangen, dass sie ein Objekt hergeben, als sie selbst gezahlt hätten, um es zu bekommen“. Seit 1980 wurde dieser Effekt in unzähligen Versuchen – sowohl unter Labor- als auch unter realen Bedingungen – nachgewiesen, häufig mit Hilfe eines Kaffeebechers. Stellen Sie sich vor, ich hätte einige Kaffeebecher und würde Ihnen einen davon zum Kauf anbieten. Den Preis dürften Sie bestimmen. Sagen wir, Sie bieten mir zwei Euro, und ich schlage ein. Nehmen wir nun an, ich würde den Becher sofort wieder zurückkaufen wollen, zu dem zuvor vereinbarten Preis von zwei Euro. Würden Sie ihn hergeben? Die meisten Menschen nicht. Sie verlangen einen höheren Preis, zwischen drei und fünf Euro.
Warum ist das so? Thaler zog die Schlussfolgerung, dass man einem Gegenstand, den man besitzt, als wertvoller empfindet als zu der Zeit, als man ihn noch nicht hatte. Diese Denkweise widerspricht der klassischen Wirtschaftstheorie, der zufolge in einem solchen Fall eine völlige Übereinstimmung der Bereitschaft zu erwarten wäre.
Anleger sind ebenfalls nicht vor dem Besitzeffekt gefeit. Vielmehr gilt auch beim Investieren: Was man erst einmal hat, will man so leicht nicht mehr hergeben – auch wenn es um die Aktien, Anleihen und Fonds im eigenen Portfolio geht. Bei der Beurteilung unserer Wertpapiere ist es typisch, durch eine rosarote Brille zu schauen. In Zeiten des Neuen Markts hatte diese Denke häufig katastrophale Folgen: „Die Aktie kommt schon wieder“, war eines der häufigen Argumente für ein Festhalten an Papieren, die noch Jahre später als Pennystocks dahindümpelten. Kostet eines unserer Papiere am Markt zehn Euro, gehen wir ganz selbstverständlich davon aus, dass es eigentlich mehr wert ist – schon bevor wir den Wert überhaupt analysiert haben. Es ist wohl offensichtlich, dass der Besitzeffekt uns damit einen Bärendienst erweist. Um nicht in diese Falle zu tappen, müssen wir deswegen genau ermitteln, welchen Wert Papiere haben, sowohl die in unserem Besitz als auch die, die wir nicht in unserem Portfolio haben.
Ich zögere etwas, die Vorteile von ETPs in Bezug auf den Besitzeffekt anzupreisen, denn schließlich geht ein solches Papier genauso wie eine Aktie oder einen Fonds in den Besitz eines Investors über. Allerdings verliert der Besitzeffekt bei ETPs wegen des homogenen Aufbaus der Produkte etwas von seinem „Schrecken“. Vielleicht können Anleger durch die mit einem ETP-Invesmtent verbundene Entpersönlichung leichter objektivere Entscheidungen fällen als wenn sie Empathie für einen Fondsmanager aus Fleisch und Blut beziehungsweise für seine diskretionären Entscheidungen an den Tag legen? ETPs implizieren zudem eine aktive Handelsstrategie; die Fonds nehmen nur die Funktion von Bausteinen in der Vermögensallokation ein – sie sind eben keine „Fanobjekte“!
Der Besitzeffekt dürfte bei ETPs am ehesten dann Wirkung zeigen, wenn man zwei Produkte miteinander vergleicht, die sich nicht auf denselben Index beziehen. Hier hat man bei ETPs Vorteile. Sie brauchen nur einen Blick auf die Morningstar-Fondskategorie der europäischen Standardwertefonds zu werfen. Sie umfasst drei Subkategorien mit jeweils hunderten von Fonds. Zwischen diesen aktiv gemanagten Fonds gibt es nicht nur Unterschiede, sondern es besteht auch Potenzial für viel Verwirrung. Natürlich gibt es inzwischen viele Standardwerte-ETPs für Europa-Aktien und auch etliche Strategie-ETFs, die ebenfalls auf unterschiedliche Anlagestile ausgerichtet sind. Wenn Sie sich also entschlossen haben, in ein ETP zu investieren, weil es anders aufgebaut ist als andere, dann schätzen Sie dessen Wert aller Wahrscheinlichkeit nach höher ein als den ähnlicher Produkte. (Sonst hätten Sie das Papier schließlich gar nicht erst gekauft!). Aber wer einen ETP analysiert, hat sich Gedanken über den zugrunde liegenden Index gemacht. ETP-Investoren machen idealerweise ihre Hausaufgaben und treffen ihre Investitionsentscheidungen nach soliden, fundamentalen Kriterien. Ändern sich beispielsweise die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland oder der Schweiz, dann sollte ein ETP-Anleger automatisch prüfen, ob die Voraussetzungen weiter gegeben sind, den Dax- oder SMI-ETF zu halten. Der fundamentale Check dürfte es dem Anleger ermöglichen, zumindest etwas neutraler „seinen“ Wertpapieren gegenüber zu stehen.
Jeder Investor sollte sich über die Gefahren des Besitzeffekts im Klaren sein und die verschiedenen Produkte - soweit es geht - objektiv bewerten, vor allem, wenn man einen oder mehrere der Titel schon im Depot liegen hat.
Im nächsten Teil dieser Serie werden wir das Thema „Selbstüberschätzung“ angehen. Warum geben 80 Prozent der Autofahrer in Umfragen an, sie seien besser als der Durchschnitt? Das ist schon rein rechnerisch unmöglich! Auf der Suche nach einer Erklärung für diesen Denkfehler werden wir zwei weiteren Phänomenen begegnen: Der schlechten Angewohnheit, Entscheidungen nur anhand der Ergebnisse zu beurteilen (dieses Verhalten wird wissenschaftlich „Outcome Bias“ genannt) und der Unart, unliebsame Informationen einfach zu ignorieren („Bestätigungsfehler“ oder „confirmation bias“). Drei weitere Angewohnheiten, die schwere Folgen für einen Investor nach sich ziehen können.